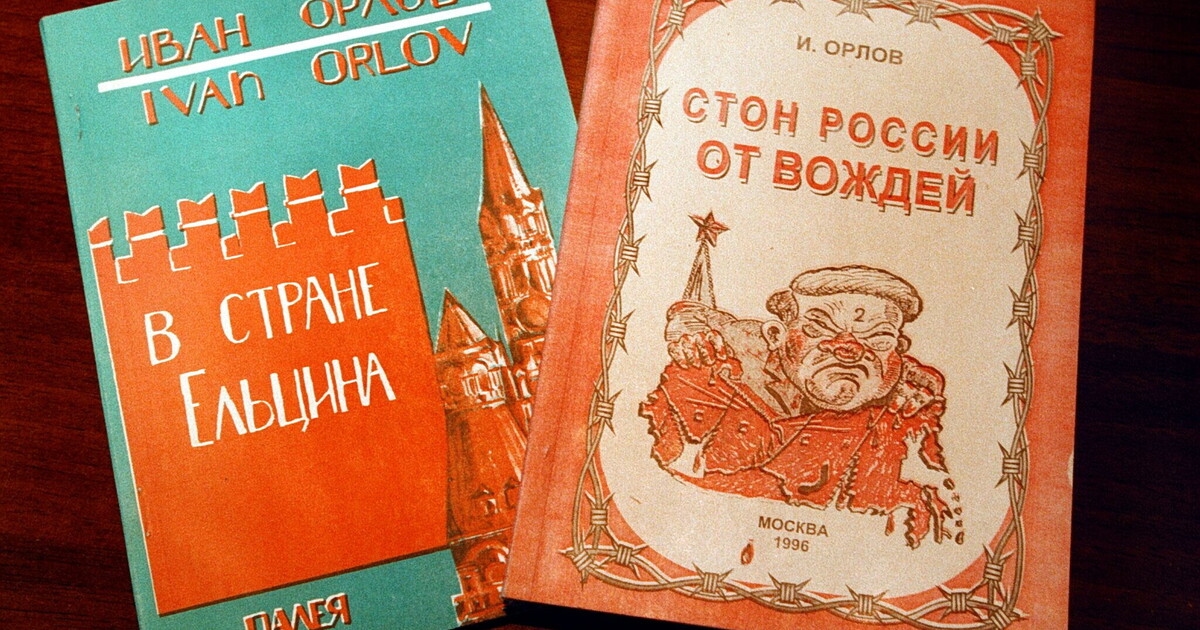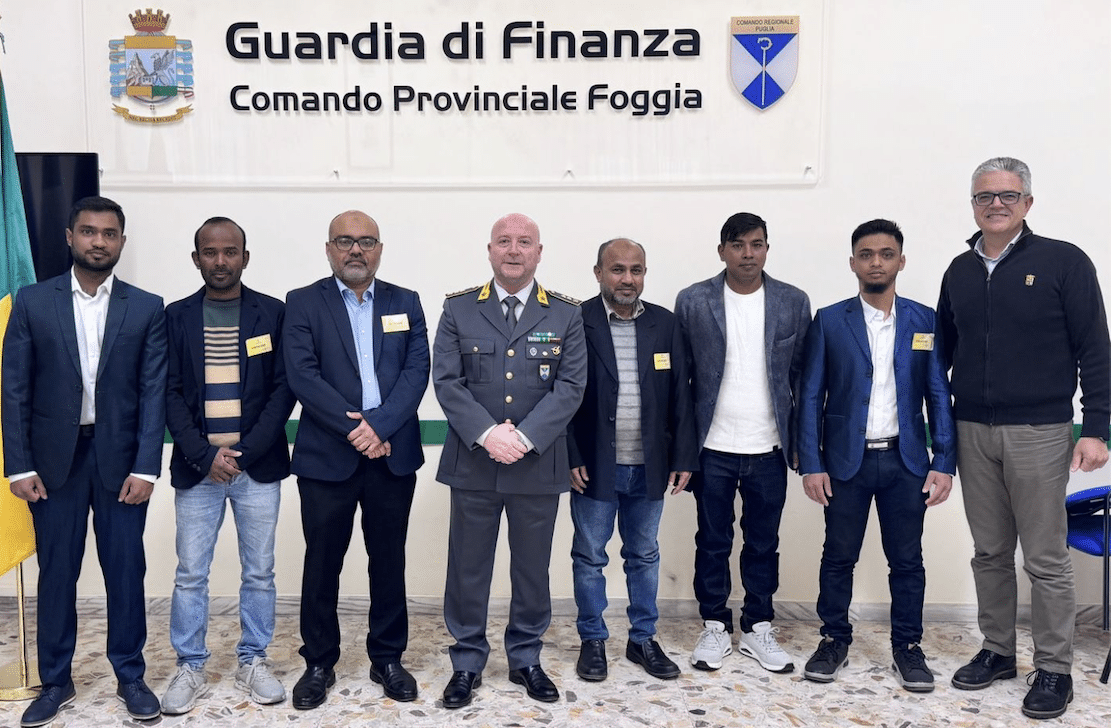„Der Tod von Jus Belli“: Cacciari schlägt Alarm auf der Biennale

„Nichts wird mehr so sein wie vorher, wenn man die Grundprinzipien seiner Kultur getötet hat.“ Mit diesem Satz, gesprochen mit ernster und klarer Stimme, hielt Massimo Cacciari heute Abend auf der Biennale in Venedig einen seiner eindringlichsten und prophetischsten Vorträge mit dem Titel „Der Tod des Jus Belli. Kriege und Frieden“. Eingeleitet vom Präsidenten der Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, der diese neue Veranstaltung der Biennale della Parola präsentierte, und mit Grußworten des Patriarchen von Venedig, Monsignore Francesco Moraglia, verknüpfte der Philosoph die Reflexionen von Immanuel Kant („Für den ewigen Frieden“) und Ernst Jünger („Frieden – Ein Wort an die Jugend Europas und die Jugend der Welt“) zu einer Rede, die zugleich politische Analyse, moralische Diagnose und bürgerlicher Appell war.
Cacciaris These ist eindeutig: Der heutige Krieg hat jede Unterscheidung zwischen Militär und Zivilbevölkerung, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Krieg und Vernichtung aufgehoben. „Es gibt kein Kriegsrecht mehr. Wo das Militär ist, ist auch die Zivilbevölkerung. Und gemeinsam sind sie der Feind. Es ist ein absoluter Krieg, ein Vernichtungskrieg“, sagte Cacciari.
Der venezianische Philosoph prangert eine radikale Transformation des Konflikts an, die einen historischen Bruch mit allen bisherigen Gegebenheiten markiert. Während in der Vergangenheit selbst die grausamsten Kriege zumindest formal Grenzen und Regeln anerkannten, ist dieses fragile Bollwerk heute – so Cacciari – vollständig zusammengebrochen. Wir kämpfen nicht mehr gegen Armeen, sondern gegen ganze Völker; nicht gegen politische Gegner, sondern gegen deren Existenz selbst. Daraus ergibt sich die grundlegende Frage: Was geschieht mit dem Völkerrecht, dem „Recht auf Frieden“, wenn der Krieg absolut wird?
Für Cacciari verliert Europa seine rechtlichen und moralischen Wurzeln und gaukelt sich vor, alles könne wieder so werden wie früher, als „der Feind beseitigt“ war. Doch damit, warnt er, „bricht nicht nur das Recht, sondern die europäische Zivilisation selbst zusammen.“
Die letzte Aufgabe liegt bei den neuen Generationen. Es werde an ihnen liegen, so Cacciari, ein menschliches, soziales und kulturelles Gefüge wiederaufzubauen, das in der Lage sei, das Völkerrecht wiederherzustellen. „Es erscheint eine fast unmögliche Aufgabe, aber sie ist notwendig. Die gegenwärtigen und vergangenen Generationen sind gescheitert: Nur eine schonungslose Analyse kann die Hoffnung wiederherstellen.“
Und diese Hoffnung, so räumt der Philosoph ein, ist nicht von dieser Zeit: „Die Hoffnung liegt jenseits des Heute, jenseits der undurchdringlichsten Berge. Doch ohne sie, ohne das Bewusstsein dessen, was wir zerstört haben, kann kein Frieden entstehen.“ Mit „Der Tod des Jus Belli“ kommentierte Cacciari nicht nur die Chronik der Kriege der Gegenwart – von Gaza bis zur Ukraine –, sondern stellte auch Europas Gewissen infrage, seinen Glauben an das Recht, an die Vernunft, an die Unterscheidung zwischen Menschlichkeit und Barbarei. Eine Warnung, die wie ein Urteil klingt, aber auch wie der letzte Appell: „Denkt wieder an das Recht“, bevor es zu spät ist.
Bei der Eröffnung der Veranstaltung betonte Präsident Buttafuoco, dass die Biennale von Venedig ein Labor für freie Meinungsäußerung sein müsse, ein Bollwerk gegen die Verbannung von Themen, die heute in der öffentlichen Debatte nahezu „verboten“ seien, wie Krieg und Frieden. Buttafuoco erinnerte dann nostalgisch an den katholischen Intellektuellen Giorgio La Pira und den kommunistischen Parlamentarier Pio La Torre, zwei Symbolfiguren eines Italiens, das es verstand, Glauben und bürgerschaftliches Engagement, Dialog und Konflikt miteinander zu vereinen. „Ich erinnere mich an das Italien La Piras, der Feinde aus aller Welt nach Florenz einlud, um über Frieden zu sprechen, und an das Italien Comisos mit Pio La Torre und Millionen mobilisierten Menschen. Heute würden solche Persönlichkeiten als Staatsfeinde behandelt und des Rederechts beraubt.“
Eine Passage, die wie eine scharfe Kritik an der abgeschotteten zeitgenössischen Debatte klingt, in der Komplexität und Diskussion Vereinfachung und Intoleranz gewichen zu sein scheinen. Aus diesem Grund bekräftigte Buttafuoco die Mission der Biennale: die Gedankenfreiheit zu wahren und das gesprochene Wort als Instrument der Erkenntnisgewinnung und nicht der Propaganda zu verteidigen. „Die Biennale setzt sich für das gesprochene Wort ein“, sagte er, „und wir sind stolz auf das, was wir täglich in unserer Arbeit erreichen.“
In einer Zeit, die von Kriegen und globalen Spannungen geprägt ist, bot der Patriarch von Venedig, Monsignore Francesco Moraglia, vor Cacciaris Vortrag eine tiefgründige Betrachtung zum Thema Frieden und Krieg an. Er lud dazu ein, über Politik und Institutionen hinauszublicken und die spirituelle und moralische Dimension des Friedens neu zu entdecken. Moraglia erinnerte daran, wie die heutige Welt „von Expansionismus und neuen Technowissenschaften dominiert wird, die selbst in der Rüstungsindustrie Anwendung finden“. Angesichts dieses Szenarios beschwor der Patriarch die Relevanz von Kants Entwurf des „Zum ewigen Frieden“, in dem der deutsche Philosoph die Schaffung eines internationalen Rechtsorgans vorschlug, das Konflikte durch die Kraft des Rechts beenden kann. Doch Moraglias Betrachtung beschränkte sich nicht auf die Theorie. „Wir können die besten Gesetze und die besten Instrumente haben, aber ohne den Steuermann kann die Reise nicht vollendet werden“, bemerkte er und spielte damit auf die Krise internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen und den Mangel an politischem und moralischem Willen an, der das Gedeihen des Friedens verhindert. In seiner Rede erinnerte der Patriarch auch an das Konzept der „Strukturen der Sünde“, jener sozialen Realitäten und Dynamiken, die Ungerechtigkeit und Gewalt fortführen und sie oft mit anderen Namen verschleiern. Krieg, sagte er, „wird nicht immer Krieg genannt, sondern setzt sich in anderen Formen fort.“ Der Kern von Moraglias Botschaft ist jedoch anthropologischer Natur: Frieden entsteht nicht durch Gesetze, sondern aus dem menschlichen Herzen. Er zitierte den russischen Philosophen Nikolai Berdjajew und erinnerte daran, dass „christliche Wahrheit Freiheit voraussetzt“ und dass das Böse nicht durch Staatsgewalt, sondern durch einen inneren, spirituellen Sieg besiegt wird. „Der Staat kann Gewalt einschränken, aber er kann die Sünde nicht ausrotten“, fügte er hinzu. Moraglia schloss mit einem Appell an die persönliche und kollektive Verantwortung: „Das Gute ist nicht allein das Ergebnis von Gesetzen, sondern der Freiheit, die das Gute wählt. Wir müssen von Neuem bei der Menschlichkeit beginnen, bei ihrer Komplexität, bei ihren Wunden und bei ihrer Fähigkeit zur Erneuerung.“ Nur eine mit sich selbst versöhnte Menschheit – fügte er hinzu – werde die Gnade finden, „in Wahrheit zu leben und echten Frieden zu schaffen“. (von Paolo Martini)
Adnkronos International (AKI)